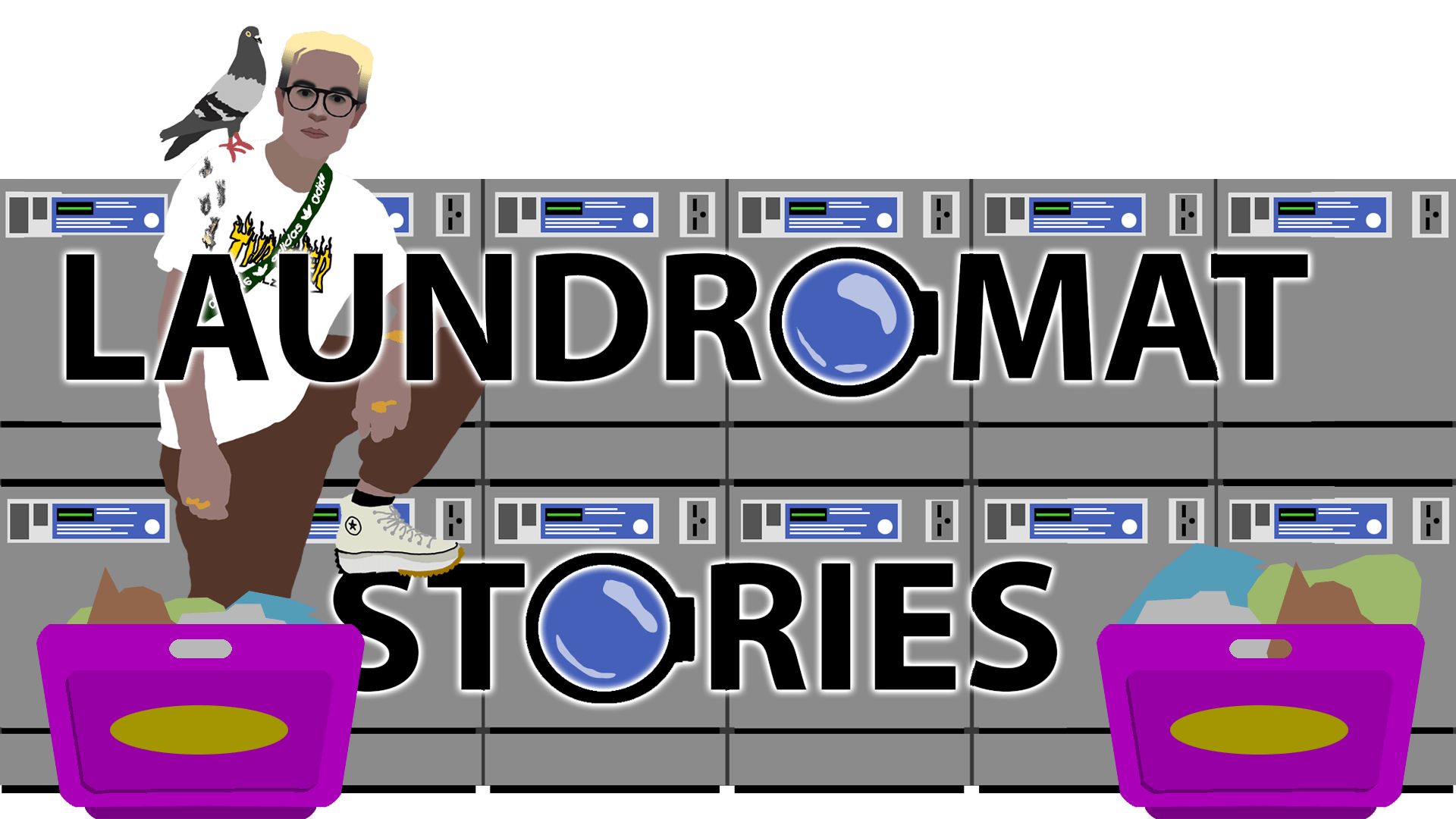Griebens Reiseführer von 1927 rät davon ab, New York im August zu besuchen: Die feuchte Hitze während des Tages und die schwülen Nächte ohne Abkühlung, wirkten erschlaffend auf jeden, der das Klima des New Yorker Sommers nicht gewöhnt sei. Auf dem selben Breitengrad wie Neapel gelegen, herrscht eine durchschnittliche Temperatur von 27 Grad bei 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wie Neapel hat auch New York ein Müllproblem. Auf Spaziergängen kommt es vor, dass ich fünfzig Meter nicht die Straßenseite wechseln kann, weil der Gehweg flankiert ist von einem Wall aus Müllsäcken. Tatsächlich produziert keine andere Metropole der Welt so viel Abfall wie New York. In der Stadt-Hymne träumt Frank Sinatra davon, König dieses Berges zu sein. Top of the heap. Wie größenwahnsinnig das ist, wird erst in Zahlen begreiflich: Allein 10.000.000 Kilo Hausmüll fallen hier täglich an.
„Mob run“, erklärt Jeff, den ich auf dem Dach meines Apartments treffe: Die New Yorker Abfallwirtschaft werde in großen Teilen von der Mafia kontrolliert. Klar, dass gerade Sinatra ein Lied davon singt.
In lower Manhattan begegne ich Pablo, der als Concierge in einem Wohnblock arbeitet. Er ist muskulös, ein echter Arbeiter-Typ.
„Three truckloads. That‘s two days.“
Routiniert greift er die schwarzen Müllsäcke aus dem Lastenaufzug und wirft sie auf die Straße. Ich zähle. An die 150 müssten es sein. Dieser Haufen gart dann im tropischen Dampfofen der städtischen Gosse. Ein Paradies für Ungeziefer. Und das ist überall. Ratten, Kakerlaken, Tauben.
Nachvollziehbar, dass Woody Allens New Yorker Protagonisten alle Neurotiker waren. Nun gehöre ich leider auch zu dieser Gattung.
Am Abend liege ich im Schweiß, wälze mich hin und her. Die Matratze ist noch feucht von letzter Nacht. 40 Grad sind es in meiner sechs Quadratmeter großen Kammer, die mit 1800 Dollar pro Monat spottbillig gilt. Wer so günstig wohnt – zu 300$/m² – muss sich das Apartment allerdings teilen: In den Wänden scharrt es. Etwas gräbt sich in meinen fiebrigen Halbschlaf ein. Immer wieder schrecke ich auf, mache Licht, prüfe den Riss an der Decke, das Loch in der Wand. Ob sich etwas bewegt. Am nächsten Morgen finde ich eine Kakerlake auf dem Boden. Rücklings liegt sie da, mit zuckenden Gliedern. Neben ihr eine Pfütze braunen Sekrets.
„That‘s normal.“, sagt mein Vermieter, „You‘re in New York.“
Schlimmer als Kakerlaken sind für mich nur Tauben. Bei Straßentauben beispielsweise wurden neben zahllosen Viren und Pilzerkrankungen 41 humanpathogene Bakterienarten festgestellt. Einige davon können Organversagen, Lungen- oder Gehirnhautentzündung verursachen. Die Stadt, die nie schläft, wimmelt nur so von ihnen.
Obwohl ich Zickzack laufe, weite Bögen um Laternen schlage, auf denen sie sitzen, geschieht das Unausweichliche: In einem Moment der Unachtsamkeit trifft es mich auf den Straßen Harlems. Eine dickflüssige, weißmelierte Masse, ummantelt von öligem Sekret, läuft mein T-Shirt hinab. Dieses edle Bio-Ferment verschimmelter Pizza-Slices, angereichert mit Bakterien und Parasiten, ist – das wissen Connaisseure – am Reichhaltigsten im Big Apple.
Deshalb gibt es hier auch so viele Waschsalons. Man könnte meinen, die Leute haben keine Waschmaschinen zu Hause. Aber das ist nicht der Grund. New York ist einfach so vermüllt, dass man auf dem zweieinhalbstündigen Arbeitsweg etwa vier bis fünf Mal an einem Laundromat zwischenstoppen und die gesamte Kleidung waschen muss, um sauber im Büro anzukommen.
Inzwischen tropft Kot auf meinen Arm hinab. Meine Kopfhaut juckt. Ich kann schon fühlen, wie die Parasiten mich befallen. Schnelles Handeln ist gefordert, sonst friste ich bald ein Dasein unter dem menschlichen Äquivalent der Tauben: Verdaue an der Wallstreet große Haufen Müll zu einer infektiösen Essenz, um diesen saftigen Triple-A-Rating-Dünnschiss dann von oben herab auf das gemeine Volk der für Mieten verschuldeten Bürgerinnen zu defäkieren.
Also schnell das T-Shirt loswerden. Am liebsten will ich es ausziehen, doch ich traue mich nicht. Vermutlich ist es impliziter Rassismus, aber ich fühle mich zusätzlich dadurch gehemmt, der einzige Weiße im gesamten Straßenzug zu sein. Weiß eben leider auch von Taubenkot.
Lexington 125 steht auf dem Schild der Subway. In einer Seitenstraße haben Jugendliche einen Hydranten aufgeschraubt. Einer zerstäubt den Wasserstrahl mit der Hand, während die anderen sich im künstlichen Regen erfrischen. Ich beneide sie eine Weile und wende mich schließlich Rat suchend an eine Frau.
„What’s up, honey?“, fragt sie mich lächelnd. Ich erkläre mein Dilemma. Ob es hier erlaubt sei, oberkörperfrei herum zu laufen? Erlaubt schon, antwortet sie, taxiert mich einmal von Kopf bis Fuß und fügt dann hinzu:
„But I wouldn’t recommend it.“
Zwei Blocks weiter kaufe ich ein frisches T-Shirt, einen halben Liter Desinfektionsmittel, eine Gallone Wasser und Klopapier. Dann knie ich mich an den Rinnstein und beginne, mich zu waschen. Ich reibe meinen Arm mit Desinfektionsmittel ein, spüle ihn ab und trockne ihn dann. Diesen Vorgang wiederhole ich ungefähr zehn Mal. Neben mir häuft sich das zermatschte Toilettenpapier. Eine Passantin schlägt einen weiten Bogen um mich, ein Junge wechselt die Straßenseite. Mache ich etwas falsch?
Psychoanalyse ist out, seit man sich online auf Basis einzelner Tweets Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Dabei wurde sie in dieser Stadt dereinst zum Lifestyle erhoben. Der zwischen Redaktions-Besprechungen und Galapartys eingeschobene Couchbesuch, bei dem man die Spielarten des urbanen Liebeslebens glossierte, gehörte in jeden New-York-Film.
Der persönliche Film, den ich nun schiebe, gäbe Anlass für ein Come-Back: In der Wasserlache im Rinnstein spiegelt sich ein zersauster Kerl mit irrem Blick – der Inbegriff des neurotischen Typus. Meine Desinfektions-Routine, die sich während der Pandemie elegant unter dem Mantel solidarischen Handelns verbarg, tritt mir erstmals in ihrem ganzen pathologischen Ausmaß vor Augen – als lehrbuchgültige Sublimierung analer Zwänge. Erstaunlich, wie blind man sich selbst gegenüber ist. Wäre ich auf Twitter, hätte sich gewiss jemand erbarmt, mir diese Erkenntnis-Leistung abzunehmen.
Nach meiner großen Waschung besuche ich einen Laundromat an der 2nd Ave. Hier wurde ich neulich schon einmal mit dem Anliegen abgewiesen, meine Schuhe zu waschen. Das T-Shirt wird mir aber erlaubt.
Während ich warte, skizziere ich im Kopf eine Kolumne. Mir gefällt der Titel „Laundromat Stories“, weil man die Os als Waschmaschinen-Luken darstellen kann. Allerdings suggeriert der Titel vielleicht, ich würde in den Laundromats interessante Begegnungen mit Leuten machen, die mir ihre Lebensgeschichten erzählen. Das ist nicht der Fall. Ich bin hier einer von den sonderbaren Typen, die mit hypernervösem Blick zusammengekauert in der Ecke sitzen und unsichtbare Flusen von ihrer Hose abpiddeln. Ich bin einer von denen, die man lieber nicht anspricht. Fast ein echter New Yorker.